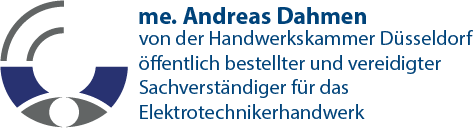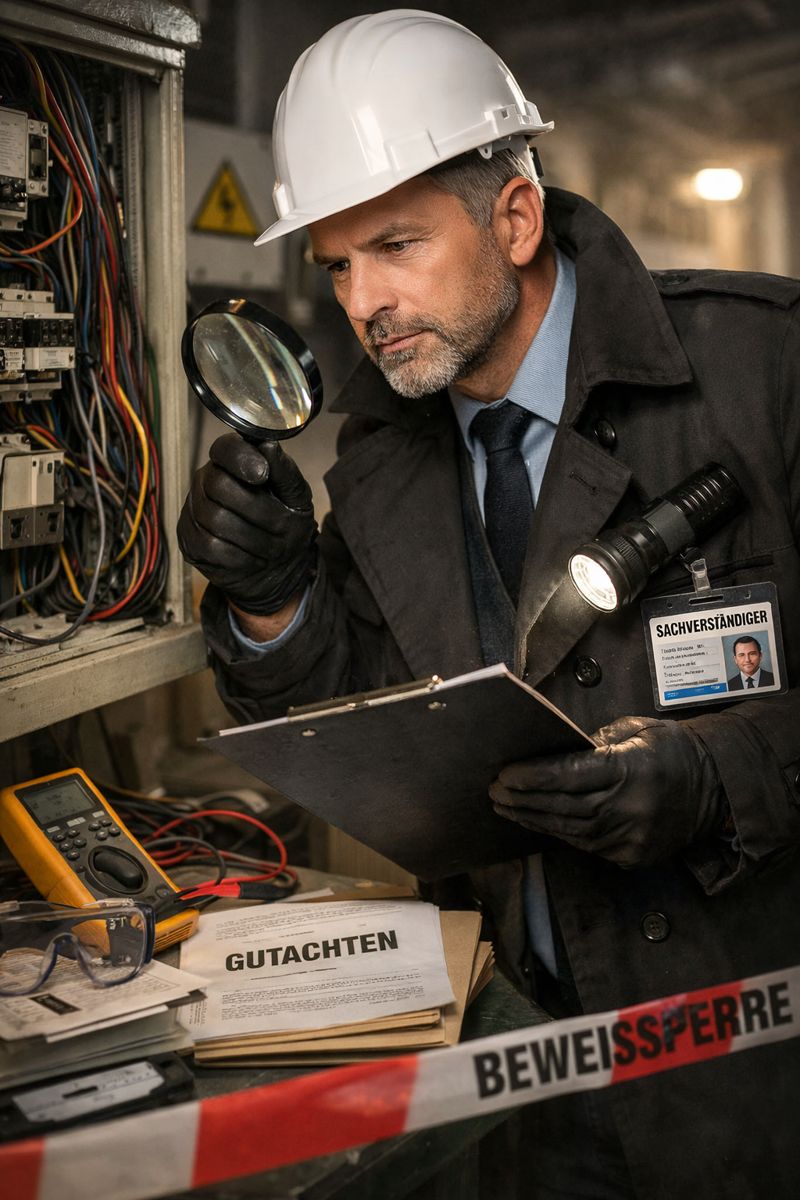Die VDE 0701 0702 Geräteprüfung ist für alle Arbeitgeber verpflichtend, sobald elektrische Betriebsmittel von Beschäftigten genutzt werden. Sie bildet zusammen mit der DGUV Vorschrift 3 die Grundlage für die elektrische Sicherheit im Betrieb und ist keine freiwillige Maßnahme, sondern eine verbindliche Unternehmerpflicht.
rechtliche Grundlagen und warum die Qualifikation des Prüfers entscheidend ist
Elektrische Geräte sind aus dem Arbeitsalltag nicht wegzudenken. Computer, Monitore, Ladegeräte, Kaffeemaschinen, Werkzeuge oder medizinische Geräte werden täglich genutzt. Was dabei häufig unterschätzt wird, ist die Verantwortung des Arbeitgebers für den sicheren Zustand dieser Betriebsmittel.
Die Geräteprüfung nach VDE 0701 und VDE 0702 bildet zusammen mit der DGUV Vorschrift 3 die Grundlage für die elektrische Sicherheit im Betrieb. Sie ist keine freiwillige Maßnahme und keine bloße Formalität, sondern eine verbindliche Pflicht mit hoher sicherheitsrechtlicher und haftungsrechtlicher Bedeutung.
Wer diesen Zusammenhang versteht, erkennt schnell, dass es bei der Geräteprüfung nicht um das Anbringen von Prüfplaketten geht, sondern um den nachweisbaren Schutz von Menschen und Sachwerten.
Wer ist von der VDE 0701 0702 Geräteprüfung betroffen
Jeder Arbeitgeber ohne Ausnahme
Die Prüfpflicht betrifft alle Arbeitgeber, unabhängig von Branche, Betriebsgröße oder technischem Hintergrund. Entscheidend ist allein, ob Beschäftigte elektrische Betriebsmittel nutzen.
Betroffen sind unter anderem:
- Versicherungsbüros und Makler
Büroarbeitsplätze mit PC, Monitor, Netzteilen, Druckern, Ladegeräten und Mehrfachsteckdosen gelten vollständig als prüfpflichtige elektrische Betriebsmittel. - Steuerberater, Rechtsanwälte und Kanzleien
Auch hier stehen IT-Arbeitsplätze, Server, Scanner, Aktenvernichter und Küchengeräte im Fokus der Geräteprüfung. - Friseursalons und Kosmetikstudios
Föhne, Glätteisen, Behandlungsgeräte, Verlängerungsleitungen und Steckdosenleisten unterliegen einer erhöhten mechanischen und thermischen Beanspruchung. - Arztpraxen und therapeutische Einrichtungen
Medizinische Elektrogeräte, Behandlungsplätze, Netzteile und Bürogeräte müssen regelmäßig geprüft werden, um Gefährdungen für Personal und Patienten auszuschließen. - Einzelhandel, Gastronomie und Hotels
Kassensysteme, Küchengeräte, Beleuchtung, Reinigungsgeräte und mobile elektrische Betriebsmittel gehören zu den typischen Prüfobjekten. - Handwerksbetriebe und Industrieunternehmen
Elektrowerkzeuge, Maschinen, Verlängerungsleitungen, mobile Verteiler und Betriebsmittel unter teils rauen Umgebungsbedingungen.
Wichtig ist dabei:
Die Prüfpflicht richtet sich nicht nach der Branche, sondern ausschließlich nach der Nutzung elektrischer Betriebsmittel durch Beschäftigte. Bereits ein einzelner Büroarbeitsplatz begründet diese Pflicht.
Rechtliche Grundlage: DGUV Vorschrift 3
Die rechtliche Grundlage für die Geräteprüfung bildet die DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“. Sie verpflichtet den Unternehmer dazu, elektrische Anlagen und Betriebsmittel
- vor der ersten Inbetriebnahme
- nach Änderungen oder Instandsetzungen
- sowie in regelmäßigen Zeitabständen
auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen zu lassen.
Dabei ist ausdrücklich geregelt, dass diese Prüfungen durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft durchzuführen sind.
Die DGUV Vorschrift 3 schreibt bewusst keine detaillierten Messverfahren vor. Stattdessen verweist sie auf die anerkannten Regeln der Technik. Genau hier kommen die Normen VDE 0701 und VDE 0702 zur Anwendung.
Was regelt die VDE 0701 / 0702 Geräteprüfung im Betrieb
Die Normen VDE 0701 und VDE 0702 konkretisieren die Prüfanforderungen für elektrische Betriebsmittel.
VDE 0701 gilt nach Reparatur oder Instandsetzung eines Gerätes.
VDE 0702 gilt für die wiederkehrende Prüfung im laufenden Betrieb.
Ziel dieser Prüfungen ist nicht nur der formale Nachweis, sondern die sicherheitstechnische Bewertung des tatsächlichen Gerätezustands.
Typische Prüfinhalte sind:
- Sichtprüfung auf mechanische, thermische oder äußere Schäden
- Messung des Schutzleiterwiderstands
- Messung des Isolationswiderstands oder Ersatzableitstroms
- Funktionsprüfung
Diese Prüfungen liefern Messwerte. Sie sind keine einfache Ja-Nein-Entscheidung.
Wer darf prüfen
Formale Zulässigkeit und praktische Realität
Die DGUV Vorschrift 3 definiert klar, wer als Elektrofachkraft gilt. Es handelt sich um eine Person, die aufgrund fachlicher Ausbildung, Kenntnisse, Erfahrung und Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage ist, Arbeiten zu beurteilen und mögliche Gefahren zu erkennen.
Formal dürfen Prüfungen auch unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft erfolgen. In der Praxis führt diese Regelung jedoch häufig zu Missverständnissen und zu Prüfungen, die zwar formal dokumentiert, fachlich aber unzureichend sind.
Warum eine Elektrofachkraft mit Prüferfahrung die deutlich bessere Wahl ist
Moderne Prüfgeräte liefern häufig eine automatische Gut- oder Schlecht-Bewertung. Diese Anzeige basiert auf hinterlegten Grenzwerten, ersetzt jedoch keine fachliche Bewertung.
In der Praxis zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen angelernten Prüfern, die sich ausschließlich auf die Anzeige des Messgeräts verlassen, und Elektrofachkräften mit Prüferfahrung, die Messwerte interpretieren können.
Eine erfahrene Elektrofachkraft erkennt beispielsweise:
- Schutzleiterwiderstände, die zwar noch zulässig, aber auffällig erhöht sind
- Isolationswerte, die formal normgerecht sind, jedoch auf beginnende Alterung hinweisen
- typische Schadensbilder bestimmter Gerätetypen
- Messwertverläufe, die auf zukünftige Ausfälle hindeuten
Diese Bewertungskompetenz entsteht nicht durch ein Prüfgerät, sondern durch Erfahrung, Fachwissen und Praxis.
Sachverständige Bewertung statt reiner Messung
Eine Geräteprüfung ist keine reine Messhandlung, sondern eine fachliche Beurteilung des Sicherheitszustands.
Im Schadensfall wird nicht gefragt, ob ein Gerät „bestanden“ hat, sondern ob die Prüfung fachgerecht durchgeführt wurde, ob Messwerte nachvollziehbar bewertet wurden und ob der Prüfer fachlich geeignet war.
Gerichte, Versicherungen und Berufsgenossenschaften betrachten dabei nicht nur das Prüfprotokoll, sondern auch die Qualifikation der prüfenden Person.
Vorsicht bei unrealistischen Pauschalangeboten zur Geräteprüfung
Auf dem Markt finden sich zunehmend Dienstleister, die Geräteprüfungen nach VDE 0701 und VDE 0702 zu Pauschalpreisen von etwa 5 Euro pro Gerät anbieten. Für Arbeitgeber klingt das zunächst attraktiv. Aus fachlicher Sicht sind solche Preise jedoch nicht realistisch und regelmäßig ein Hinweis auf nicht normkonforme Prüfverfahren.
Eine normgerechte Geräteprüfung setzt voraus, dass jedes elektrische Betriebsmittel einzeln geprüft wird. Dazu zählen ausdrücklich:
- jedes einzelne elektrische Gerät
- jede Mehrfachsteckdose
- jede Verlängerungsleitung
- jede Kaltgeräteleitung
In der Praxis bedeutet das, dass ein Büroarbeitsplatz vollständig zerlegt werden muss. Alle Geräte werden vom Netz getrennt, einzeln geprüft, dokumentiert und anschließend wieder ordnungsgemäß aufgebaut.
Häufige Praxis bei Billigangeboten
In der sachverständigen Praxis begegnet man immer wieder Konstruktionen, bei denen ein kompletter Schreibtisch in einer einzigen Messung geprüft wird, ohne auch nur ein Gerät auszustecken. Die Messung erfolgt lediglich an einer Steckdosenleiste.
Solche Vorgehensweisen sind nicht normkonform. Weder die VDE 0701 noch die VDE 0702 sehen eine Sammelprüfung mehrerer Geräte in Reihe vor. Messwerte sind stets gerätespezifisch zu erfassen und zu bewerten.
Eine pauschale Messung sagt nichts über den Zustand der einzelnen angeschlossenen Betriebsmittel aus.
Normgerechte Prüfung bedeutet Aufwand
Eine fachgerechte Geräteprüfung bedeutet in der Realität:
- Arbeitsplatz vollständig zerlegen
- jedes Gerät einzeln prüfen
- jede Leitung separat messen
- Prüfergebnisse dokumentieren
- Arbeitsplatz fachgerecht wiederherstellen
Selbst bei optimierten Abläufen ist dies mit einem Preis von 5 Euro pro Gerät wirtschaftlich nicht darstellbar.
Auch das häufig angeführte Argument, alle Geräte würden dem Prüfer bereits ausgebaut und einzeln an einen Prüfplatz gebracht, relativiert sich bei näherer Betrachtung. Ausbau, Zuordnung, Dokumentation und späterer Wiederaufbau erfordern Organisation und Sorgfalt. Selbst wenn der Kunde den Wiederaufbau selbst übernimmt, bleibt der Prüfaufwand erheblich.
Risiko für den Arbeitgeber
Für den Arbeitgeber entsteht hier ein erhebliches Risiko. Im Schadensfall wird nicht gefragt, ob geprüft wurde, sondern ob normkonform geprüft wurde.
Entscheidend ist, ob jedes Betriebsmittel einzeln geprüft wurde und ob die Prüfprotokolle fachlich nachvollziehbar sind. Eine Prüfung, die faktisch nur eine Sammelmessung darstellt, bietet keine belastbare Grundlage gegenüber Versicherungen, Berufsgenossenschaften oder Gerichten.
Verantwortung und Haftung des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber trägt die Verantwortung für die Auswahl geeigneter Prüfer, die Festlegung sinnvoller Prüffristen sowie die vollständige und nachvollziehbare Dokumentation.
Kommt es zu einem elektrischen Unfall oder zu einem Brand, werden regelmäßig folgende Fragen gestellt:
- Wurde nach DGUV Vorschrift 3 geprüft
- Wurden VDE 0701 und VDE 0702 beachtet
- War der Prüfer fachlich geeignet
Fehler in der Organisation oder bei der Auswahl des Prüfers können haftungsrechtliche und versicherungstechnische Konsequenzen haben.
Fazit aus sachverständiger Sicht
Die Geräteprüfung nach VDE 0701 und VDE 0702 betrifft jeden Arbeitgeber. Sie ist keine reine Formalität, sondern ein zentraler Bestandteil der betrieblichen Sicherheit.
Zwar erlaubt die DGUV Vorschrift 3 Prüfungen unter Leitung und Aufsicht, in der Praxis ist jedoch eine Elektrofachkraft mit fundierter Prüferfahrung die deutlich bessere Wahl. Nur sie ist in der Lage, Messwerte richtig zu interpretieren und Gefahren frühzeitig zu erkennen.
Unrealistisch niedrige Pauschalpreise sind regelmäßig ein Hinweis auf nicht normkonforme Prüfverfahren. Der vermeintliche Kostenvorteil kann sich im Ernstfall als erhebliches Haftungsrisiko erweisen.
Regelmäßige, fachgerecht durchgeführte Prüfungen schützen Beschäftigte, sichern den Betrieb und schaffen belastbare Nachweise gegenüber Versicherungen und Behörden.
Weitere Beiträge: