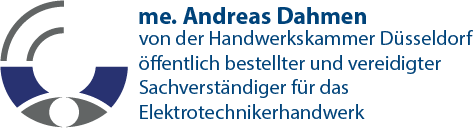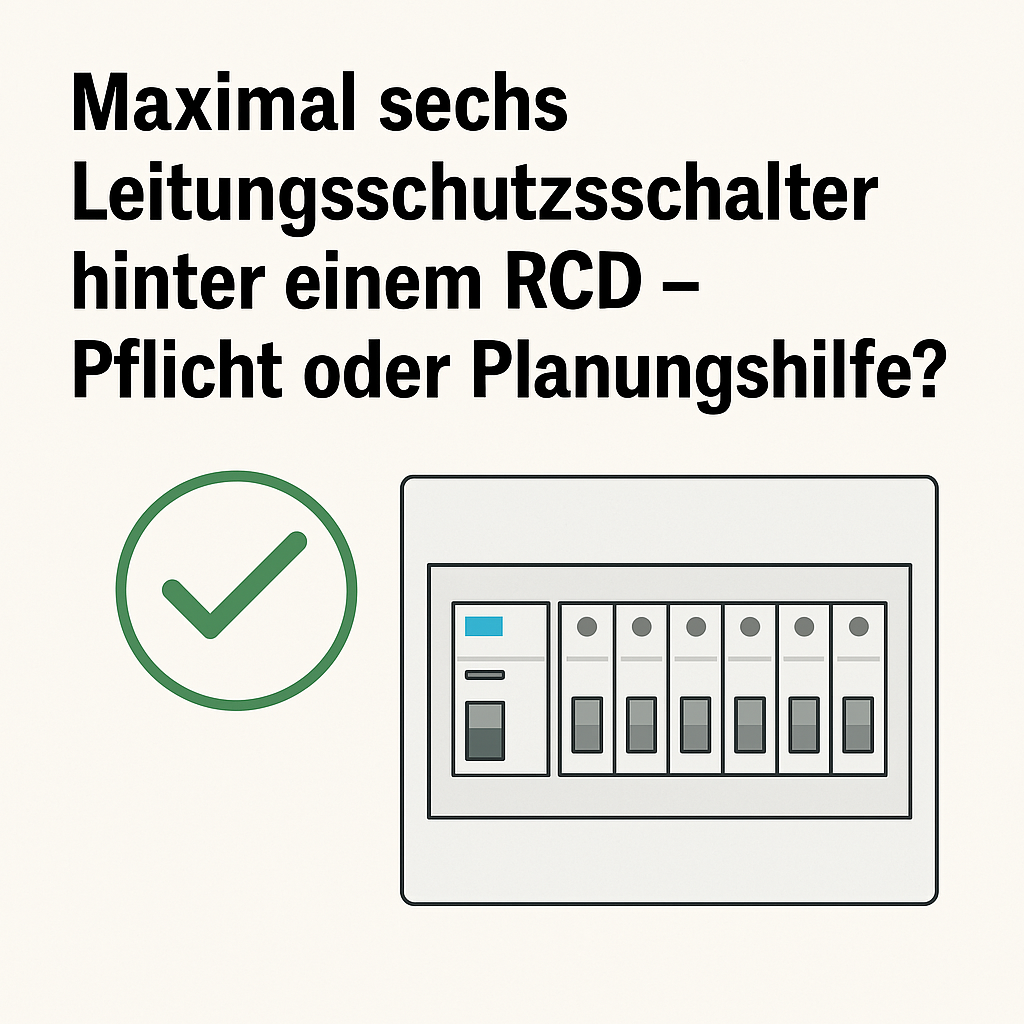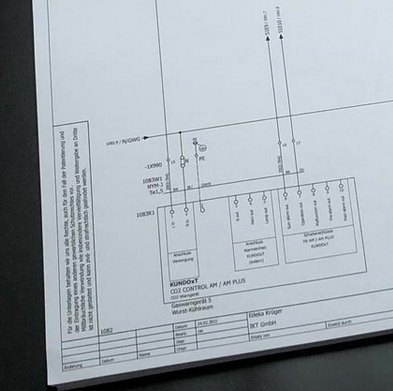Bestandsschutz in der Elektrotechnik ist ein Begriff, der in der Praxis häufig verwendet wird, jedoch regelmäßig zu Fehlinterpretationen führt. Viele Eigentümer, Betreiber und sogar Fachbetriebe gehen davon aus, dass ältere elektrische Anlagen aufgrund eines angeblichen Bestandsschutzes dauerhaft betrieben werden dürfen. Aus normativer und sicherheitstechnischer Sicht ist diese Annahme jedoch nicht zutreffend und bedarf einer klaren fachlichen Einordnung.
Herkunft des Begriffs Bestandsschutz
Im Baurecht beschreibt der Bestandsschutz, dass bauliche Anlagen, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung rechtmäßig waren, auch dann weiter bestehen dürfen, wenn sich rechtliche Anforderungen später ändern.
Dieser baurechtliche Gedanke wird häufig unzulässig auf elektrische Anlagen übertragen. Elektrotechnische Normen verfolgen jedoch einen anderen Ansatz. Sie beschreiben den Stand der Technik zum jeweiligen Zeitpunkt und sind grundsätzlich nicht rückwirkend.
Weiterbetrieb bestehender elektrischer Anlagen
Für elektrische Anlagen gilt aus fachlicher Sicht folgender Grundsatz:
Eine elektrische Anlage durfte weiter betrieben werden, wenn sie
- zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den damals anerkannten Regeln der Technik entsprach
- seitdem nicht geändert wurde
- keiner anderen Nutzung zugeführt wurde
- keine konkrete Gefährdung von Personen oder Sachen darstellte
Der Weiterbetrieb beruhte dabei nicht auf einem Bestandsschutz, sondern auf der Anerkennung eines zum Errichtungszeitpunkt regelkonformen Zustands.
Jede Änderung erfordert den aktuellen Stand der Technik
Maßgeblich ist zunächst die klare Abgrenzung zwischen einem zulässigen 1:1-Austausch und einer Änderung der elektrischen Anlage.
Der reine Austausch eines defekten Betriebsmittels gegen ein technisch gleichwertiges, funktions- und anschlussidentisches Bauteil stellt keine Änderung dar. In diesem Fall bleibt der bestehende Anlagenzustand unverändert, sodass hieraus allein keine Verpflichtung zur Anpassung an den aktuellen Normenstand entsteht.
Anders verhält es sich jedoch, sobald über einen solchen 1:1-Austausch hinaus in die Anlage eingegriffen wird. Jede Änderung einer elektrischen Anlage, unabhängig von ihrem Umfang, ist nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Stand der Technik zu planen und umzusetzen. Eine elektrotechnische Unterscheidung zwischen geringfügigen und wesentlichen Änderungen ist normativ nicht vorgesehen und fachlich nicht haltbar.
Bereits kleinste Änderungen führen dazu, dass der betroffene Anlagenteil normgerecht nach aktuellen Regeln auszuführen, zu prüfen und zu dokumentieren ist. Dazu zählen insbesondere:
- Erweiterungen oder Umverdrahtungen von Stromkreisen
- der Austausch oder die Ergänzung von Verteilungen
- der Ersatz von Betriebsmitteln, sofern dieser nicht 1:1 erfolgt
- Anpassungen an neue Verbraucher oder veränderte Lastsituationen
Ein Rückgriff auf frühere Normstände ist in diesen Fällen unzulässig.
.
Nutzungsänderung als eigenständiger Auslöser
Unabhängig von technischen Änderungen führt auch eine Nutzungsänderung zu einer Neubewertung der elektrischen Anlage.
Eine Anlage, die ursprünglich für Wohnzwecke errichtet wurde, unterliegt bei gewerblicher Nutzung anderen Anforderungen an Schutzmaßnahmen, Betriebssicherheit und Verfügbarkeit. Auch hier ist ausschließlich der aktuelle Stand der Technik maßgeblich.
Nachrüstpflichten sind die Ausnahme, nicht die Regel
Eine häufige Fehlannahme ist, dass bestehende elektrische Anlagen generell an neue Normen angepasst werden müssten. Das ist fachlich unzutreffend.
Eine allgemeine Nachrüstpflicht existiert nicht. Nachrüstungen ergeben sich nur dann, wenn
- eine konkrete Gefährdung vorliegt
- sicherheitsrelevante Mängel bestehen
- oder eine ausdrücklich geregelte Übergangs- oder Sondervorschrift greift
Ein zentrales Beispiel hierfür ist der Berührungsschutz.
Historischer Sonderfall Nachrüstung teilweiser Berührungsschutz
Unabhängig davon gab es eine zeitlich befristete Nachrüstpflicht aus dem Bereich der Unfallverhütung. Diese beruhte auf der früheren Unfallverhütungsvorschrift VBG 4 beziehungsweise BGV A2 in Verbindung mit DIN VDE 0106-100.
Diese Regelung
- betraf bestimmte bestehende elektrische Anlagen bis 1000 V
- war sicherheitsrechtlich begründet
- diente der Vermeidung konkreter Unfallgefahren
- lief am 31.12.1999 endgültig aus
Sie stellte eine klar begrenzte Ausnahme dar und begründet keinen allgemeinen elektrotechnischen Bestandsschutz.
Normen wirken nicht rückwirkend
DIN-VDE-Normen beschreiben den Stand der Technik zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sie entfalten grundsätzlich keine Rückwirkung auf bestehende Anlagen.
Für die fachliche Bewertung ist daher maßgeblich
- der Zeitpunkt der Errichtung
- der damals geltende Stand der Technik
- das Vorliegen von Änderungen
- das Vorliegen konkreter Gefährdungen
Sobald eine Änderung erfolgt, ist ausschließlich der aktuelle Stand der Technik anzuwenden.
Bedeutung für Eigentümer, Betreiber und Vermieter
Für Betreiber und Eigentümer ergibt sich daraus eine klare Konsequenz:
- Bestehende Anlagen durften weiter betrieben werden, solange sie unverändert und sicher waren.
- Jede Änderung zieht zwingend die Anwendung aktueller Normen nach sich.
- Sicherheitsmängel sind unabhängig vom Alter der Anlage zu beseitigen.
Gerade bei älteren Anlagen, Umbauten oder Nutzungsänderungen ist eine fachliche Prüfung dringend zu empfehlen, um Sicherheitsrisiken und Haftungsfragen zu vermeiden.
Fazit
Einen Bestandsschutz im elektrotechnischen Sinne gibt es nicht. Der Begriff stammt aus dem Baurecht und ist in der Elektrotechnik normativ nicht existent.
Elektrische Anlagen durften weiter betrieben werden, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den damals gültigen Regeln der Technik entsprachen und unverändert geblieben sind. Jede Änderung muss ohne Ausnahme nach dem zum Zeitpunkt der Änderung herrschenden Stand der Technik ausgeführt werden.
Nachrüstpflichten bestehen nur in wenigen, klar definierten sicherheitsrelevanten Ausnahmefällen. Der fachlich korrekte Umgang mit diesem Thema zeigt exemplarisch, dass pauschale Forderungen nach kompletten Neuinstallationen ebenso falsch sind wie der Verweis auf einen vermeintlichen Bestandsschutz.