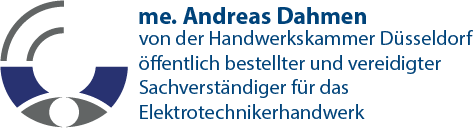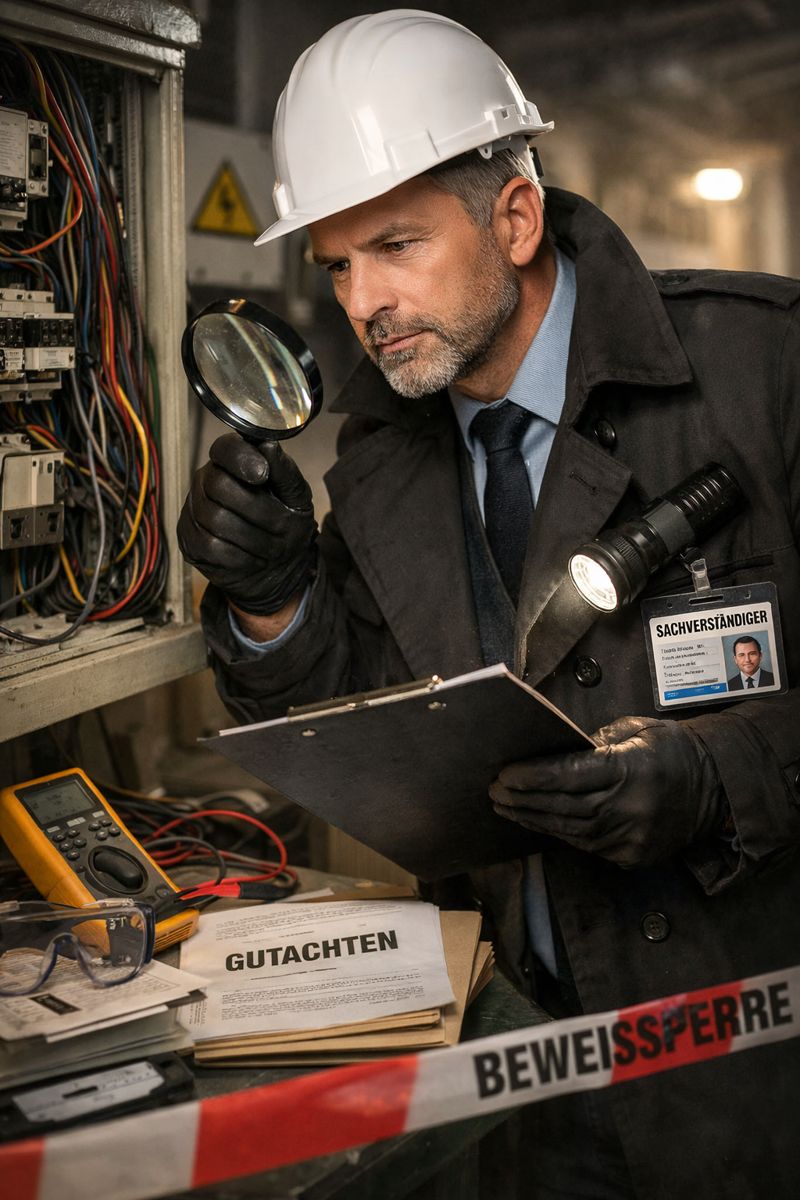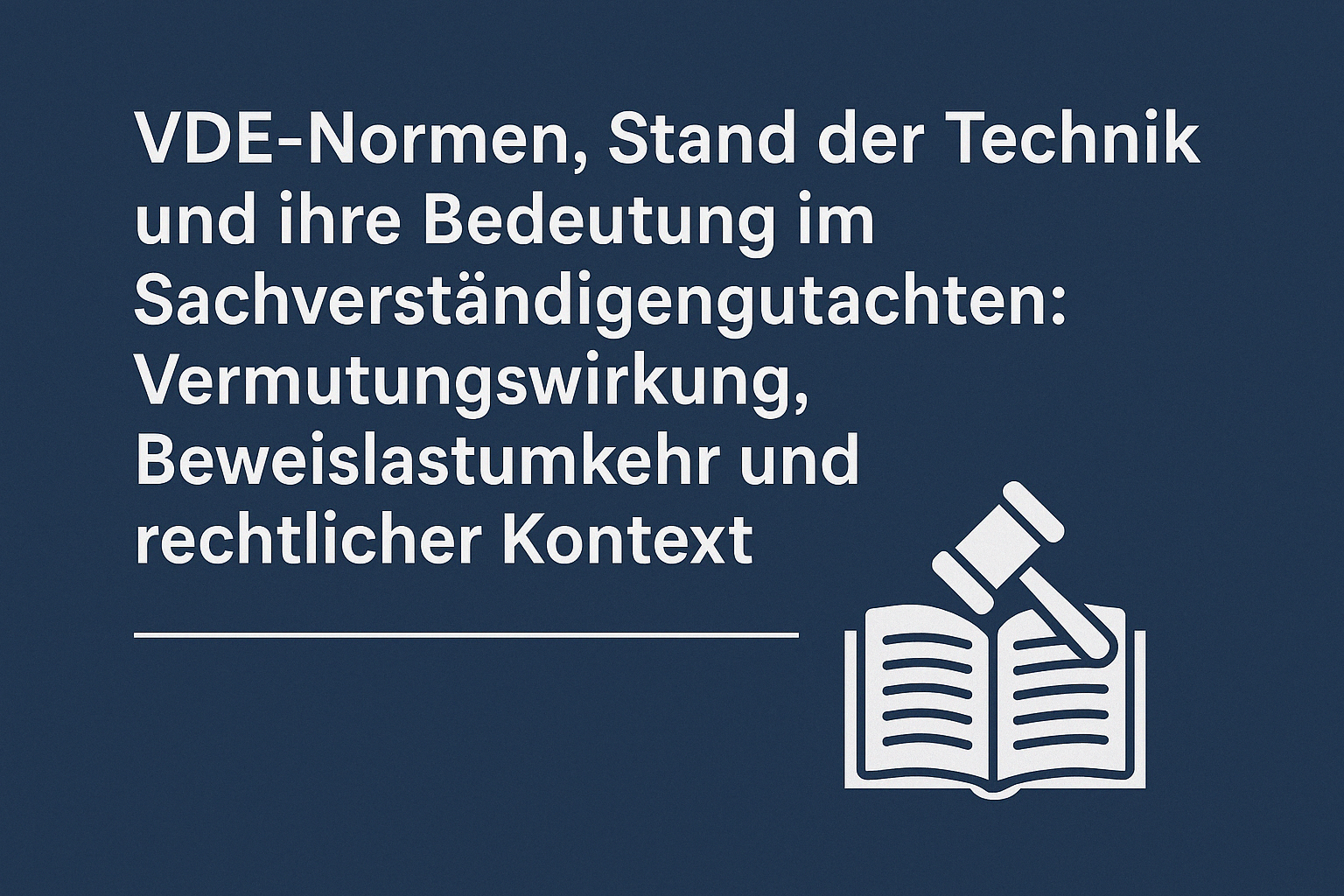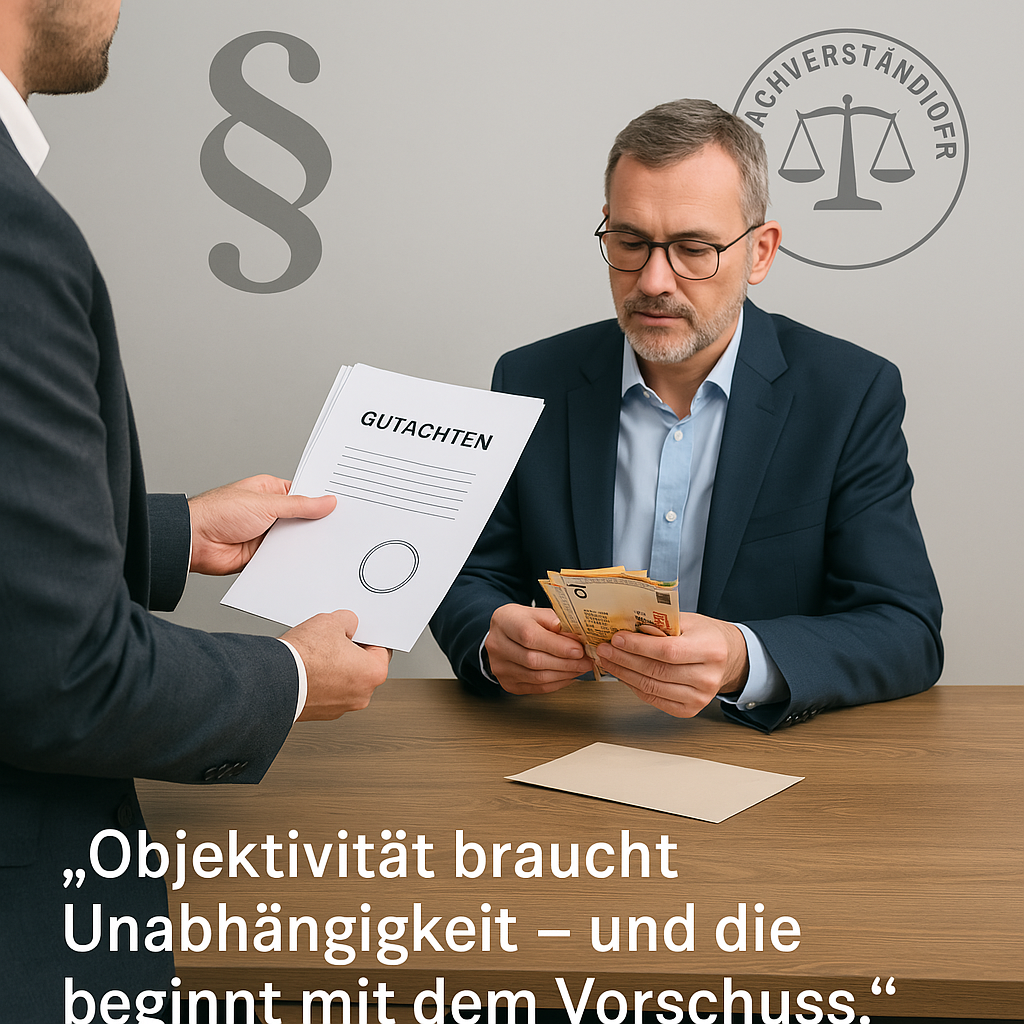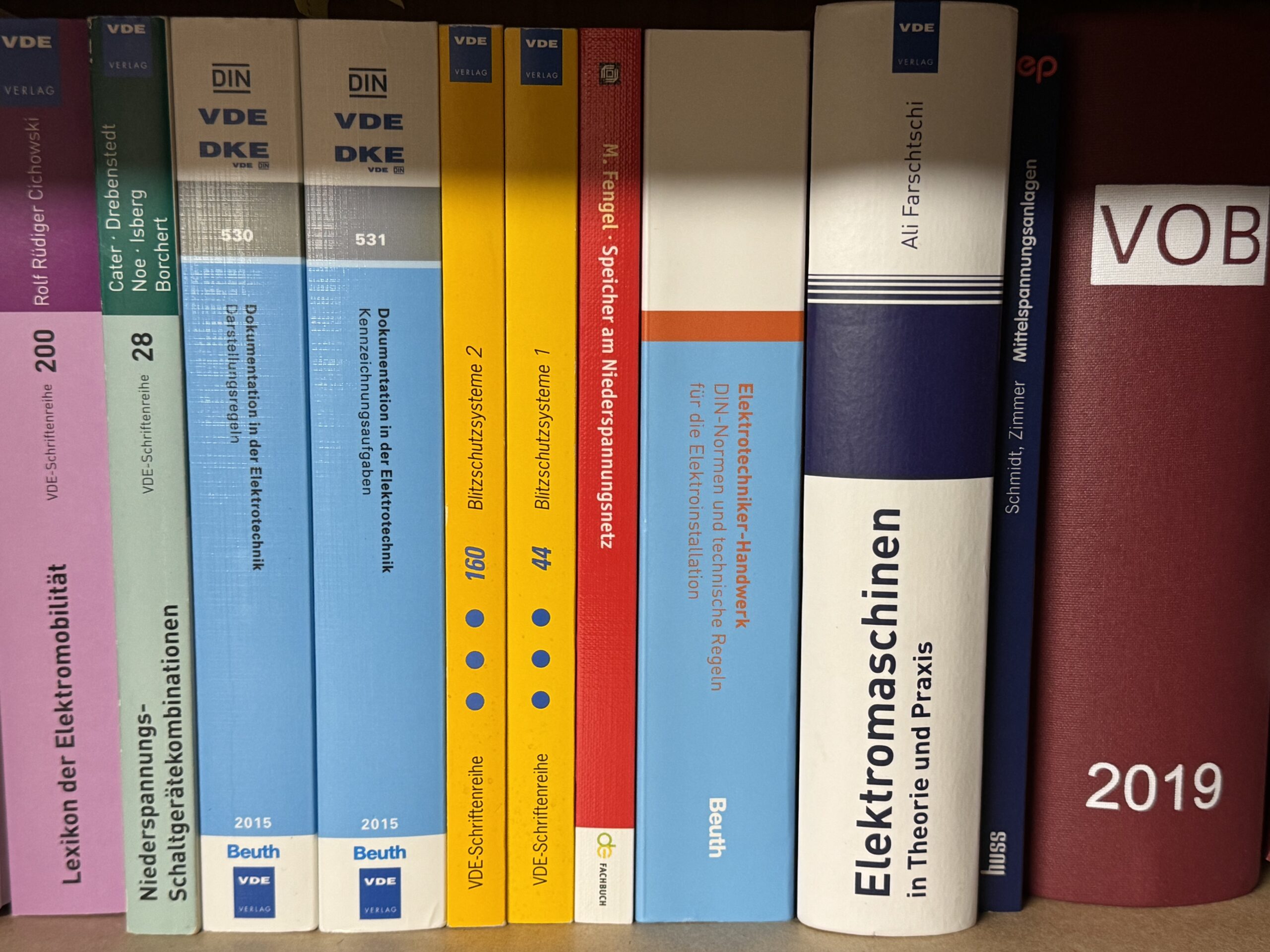Rechtliche Grundlagen und Bedeutung für elektrotechnische Gutachten
Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige nehmen eine besondere Vertrauensstellung ein. Auftraggeber, Gerichte und weitere Beteiligte müssen sich darauf verlassen können, dass technische Feststellungen sachlich, neutral und vertraulich behandelt werden. Die Schweigepflicht ist daher ein zentrales Element sachverständiger Tätigkeit und bildet die Grundlage für eine unabhängige und rechtssichere Begutachtung.
Gerade im Bereich der Elektrotechnik, in dem sicherheitsrelevante Anlagen, komplexe Normen und haftungsrelevante Fragestellungen zusammentreffen, kommt der Verschwiegenheit besondere Bedeutung zu.
Gesetzliche Grundlage der Schweigepflicht
Die Schweigepflicht des Sachverständigen ist strafrechtlich abgesichert. Maßgeblich ist § 203 Strafgesetzbuch. Danach macht sich strafbar, wer unbefugt fremde Geheimnisse offenbart, die ihm in seiner beruflichen Eigenschaft anvertraut oder bekannt geworden sind.
Der vollständige Gesetzestext ist abrufbar unter
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__203.html
Als fremde Geheimnisse gelten alle Tatsachen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht. Dies umfasst nicht nur personenbezogene Daten, sondern auch technische, wirtschaftliche und betriebliche Informationen.
Schweigepflicht nach der Sachverständigenordnung
Ergänzend zum Strafrecht verpflichtet die Sachverständigenordnung öffentlich bestellte Sachverständige ausdrücklich zur Verschwiegenheit. Die Pflicht erstreckt sich auf sämtliche Erkenntnisse, die im Rahmen der sachverständigen Tätigkeit gewonnen werden.
Die Sachverständigenordnung verfolgt dabei einen klaren Zweck. Sie soll sicherstellen, dass
Sachverständige unabhängig arbeiten können
technische Sachverhalte objektiv bewertet werden
kein Missbrauch von Informationen erfolgt
Die Verschwiegenheitspflicht ist somit keine freiwillige Selbstverpflichtung, sondern eine verbindliche Berufspflicht.
Inhalt und Umfang der Verschwiegenheit
Die Schweigepflicht umfasst insbesondere
Zustand und Ausführung elektrischer Anlagen
festgestellte Mängel und Abweichungen von Normen
Messwerte, Prüfprotokolle und Dokumentationen
Angaben zu Auftraggebern, ausführenden Unternehmen und Beteiligten
Unerheblich ist dabei, ob der Auftrag privat, außergerichtlich oder gerichtlich erteilt wurde. Entscheidend ist allein, dass die Information im Rahmen der sachverständigen Tätigkeit bekannt geworden ist.
Abgrenzung der sachverständigen Aufgabe
Die Tätigkeit des Sachverständigen beschränkt sich auf die fachliche Bewertung technischer Sachverhalte. Im elektrotechnischen Bereich bedeutet dies die Prüfung, ob eine Anlage oder Leistung zum Zeitpunkt der Begutachtung den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen Normen entsprach.
Der Sachverständige übernimmt keine Ermittlungsfunktion und trifft keine rechtlichen oder ordnungsrechtlichen Bewertungen. Diese klare Aufgabenabgrenzung ist wesentlicher Bestandteil der Unabhängigkeit und Neutralität sachverständiger Tätigkeit.
Verhältnis von Schweigepflicht und Gutachten
Die Schweigepflicht steht nicht im Widerspruch zur vollständigen Gutachtenerstellung. Im Gegenteil. Sie gewährleistet, dass alle Feststellungen offen erhoben und sachlich dokumentiert werden können, ohne dass eine unzulässige Weitergabe von Informationen erfolgt.
Ein Gutachten dient ausschließlich dem im Auftrag definierten Zweck. Eine Verwendung der Erkenntnisse außerhalb dieses Rahmens erfolgt nicht.
Grenzen der Schweigepflicht bei gerichtlichen Aufträgen
Bei einer gerichtlichen Bestellung besteht eine gesetzliche Offenbarungspflicht gegenüber dem Gericht. Der Sachverständige ist verpflichtet, seine Feststellungen vollständig, wahrheitsgemäß und nachvollziehbar darzulegen.
Auch in diesem Fall bleibt die Offenlegung strikt auf die technischen Tatsachen beschränkt, die zur Beantwortung der Beweisfragen erforderlich sind. Eine darüberhinausgehende Weitergabe von Informationen an Dritte ist unzulässig.
Bedeutung der Schweigepflicht für Auftraggeber
Für Auftraggeber schafft die Schweigepflicht Rechtssicherheit und Vertrauen. Technische Mängel, Abweichungen von Normen oder dokumentierte Zustände werden ausschließlich sachlich bewertet und nur im Rahmen des jeweiligen Auftrags verwendet.
Die Begutachtung dient der technischen Klärung und fachlichen Einordnung. Persönliche oder wirtschaftliche Bewertungen sind nicht Gegenstand sachverständiger Tätigkeit.
Fazit
Die Schweigepflicht des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist sowohl strafrechtlich als auch berufsrechtlich eindeutig geregelt. Sie bildet die Grundlage für eine unabhängige, objektive und rechtssichere Begutachtung elektrotechnischer Anlagen.
Der Sachverständige prüft ausschließlich den technischen Zustand und die normgerechte Ausführung zum Zeitpunkt der Begutachtung. Diese klare Rollenverteilung schützt alle Beteiligten und ist Voraussetzung für belastbare Gutachtenergebnisse.